|
Der Standplatz ist die
Lebensversicherung einer Seilschaft - das A und O für eine entspannte
und sichere Klettertour. Dementsprechend viel Bedeutung wird dem
Standplatzbau beigemessen.

Am
Standplatz ist es wichtig, die Übersicht zu bewahren
Die
Ausgangssituation in Bezug auf Standplätze hat sich in den letzten
Jahren grundlegend verändert. Heute werden Standplätze fast immer an
mindestens einem Bohrhaken, meist sogar an zwei Bohrhaken eingerichtet.
Die wenigen Kletterer, die Routen mit schlechten Standplätzen
(geschlagenen Haken etc.) begehen, wissen in der Regel, was sie tun. In
letzter Zeit hat das Thema "Standplatz" wieder an Bedeutung
gewonnen.
Überall, wo zwei oder mehr Kletterer beisammensitzen, hört man sie darüber
diskutieren. Allerdings hat man den Eindruck, dass die Unsicherheit
zugenommen hat. Die jahrzehntelang propagierte klassische
Ausgleichsverankerung ist (laut DAV Panorama) tot.
Reihenschaltung, fixiertes Kräftedreieck, Reihenschaltung mit Kräfteverteilung
und die "Krake" treten an deren Stelle. Und schaffen bei dem
"normal" ambitionierten Kletterer viel Verwirrung.
Deshalb wollen wir aufzeigen, welche Standplatz- und Sicherungstechniken
für die unterschiedlichen Situationen empfehlenswert sind, die der
Durchschnittskletterer vorfindet.
Die
Problemstellung
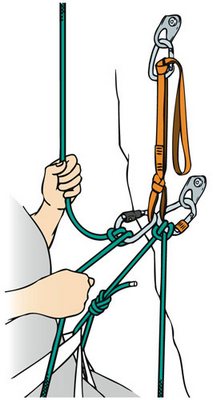
Eine
Reihenschaltung mit einer Pro-Forma-Exe im oberen Haken des
Standplatzes.
Die
klassische Ausgleichsverankerung sollte eine (möglichst) gleichmäßige
Kraftverteilung auf die Fixpunkte bewirken. Die ist vor allem vom
Winkel, der sich aus der Position der Fixpunkte ergibt, abhängig. Je
kleiner der Winkel (in Grad) desto besser die Kraftverteilung. Ab einem
Winkel von über 60 Grad wird die Kraftverteilung zunehmend ungünstiger.
Messungen der DAV-Sicherheitsforschung haben jetzt ergeben, dass die
Kraftverteilung bei der klassischen Ausgleichsverankerung aber nicht so
optimal ausfällt, wie man bisher gedacht hat (wegen Reibungsverlusten
etc.).
Darüber hinaus hat dieser Standplatzaufbau einen riesen Nachteil: Beim
Versagen eines Fixpunktes kann es (je nach Aufbau) einen zusätzlichen
Krafteintrag auf den/die verbleibenden Fixpunkt(e) geben, weil eine Ecke
der Ausgleichsverankerung absackt.
Andere Standplatzaufbauten haben eine etwas schlechtere Kraftverteilung
auf die Fixpunkte (laut DAV-Sicherheitsforschung), aber nicht den
Nachteil des Absackens bei Ausbruch eines Fixpunktes. Da heutzutage aber
(wie oben erwähnt) häufig an Routen geklettert wird, die über einen
oder mehrere zuverlässige Fixpunkte (Bohr- oder Klebehaken) am
Standplatz verfügen, stellt sich das Problem des Versagens nicht in der
Weise.
Es gilt vielmehr, eine einfache und funktionelle Verbindung der (guten)
Fixpunkte herzustellen. Die muss so geartet sein, dass sie jedem
Kletterer einleuchtet. Und dies ist die Reihenschaltung. Mit etwas Übung
ist eine Reihenschaltung an zwei Fixpunkten ebenso schnell gemacht wie
früher eine Ausgleichsverankerung.
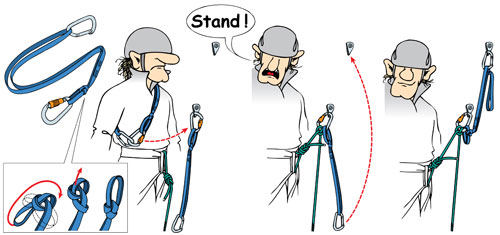
Der
doppelte Bulin. Vorteil: das Schlingenauge, in dem die
Kameradensicherung hängt, ist doppelt
.
Auch
die Hersteller haben reagiert und bieten inzwischen vorgefertigte
Reihenschaltungsschlingen an (Edelrid, Mammut), mit denen der Aufbau und
die Sicherung noch mal vereinfacht werden.
Die Partnersicherung
Ist der Standplatz aufgebaut, muss die Partnersicherung installiert
werden. Dabei unterscheiden wir grundlegend zwischen der Sicherung des
Nachsteigers und der des Vorsteigers. Die Sicherung des Nachsteigers ist
einfach und klar, sie erfolgt über den Zentralpunkt und in aller Regel
mit Platte. Interessant wird es bei der Sicherung des Vorsteigers.
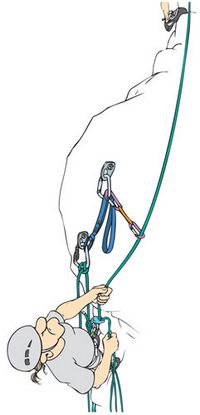
Reihenschaltung
mit der Sicherung des Vorsteigers über dem Zentralpunkt.
In
den letzten Jahren war es bei gut abgesicherten Routen Usus, den
Vorsteiger über Körper zu sichern. Mit dem Vorteil, eine komfortable,
gut zu handhabende und dynamische Sicherung zu haben.
Wichtig dabei: Um dem Sichernden nicht in den Gurt zu stürzen, wurde
unmittelbar am Standplatz die erste Zwischensicherung eingehängt (die
sogenannte Pro-forma-Exe), entweder in den Zentralpunkt oder in den
oberen Fixpunkt des Standplatzes.
Nachteil
Auf
die Zwischensicherung wirkt die 2,5-fache Kraft, die auf den Standplatz
wirkt. Somit wird bei dieser Art der ersten Zwischensicherung ein
Fixpunkt des Standplatzes (oder der ganze Standplatz) im Sturzfall
extrem belastet, zumindest bis die zweite Sicherung eingehängt ist.
Da wir aber davon ausgehen, zwei solide Fixpunkte (Bohr- bzw.
Klebehaken) zu haben, stellt das bei Bohrhaken- Standplätzen kein
Problem dar.
Die zweite Möglichkeit ist die, über den Zentralpunkt zu sichern. Das
ist weniger komfortabel, auch stellt sich die Frage des geeigneten
Sicherungsgerätes mehr als bei der Körpersicherung, und bei einem
Sturz wirkt die Fixpunktsicherung
Vorteil ist, dass für den Sicherer die Gefahr, zur Wand gerissen zu
werden, geringer ist.
Fazit
Die
einzig richtige Methode beim Aufbau von Standplätzen gibt es nicht.
Wichtig ist, dass man das System und die Problematik versteht und dann
das nötige Wissen mitbringt und situativ auf die Problemstellung
anwenden kann.
|